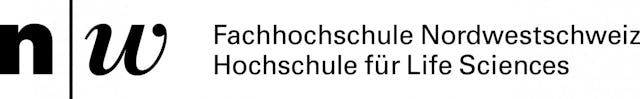Bist du an einem Masterstudium im Schnittpunkt von Natur, Technik, Medizin und Umwelt interessiert?
Inmitten der grössten Life Sciences-Industrie Europas richtet die Hochschule für Life Sciences FHNW mit dem Studiengang Master in Life Sciences und seinen neun Spezialisierungen ihren Fokus auf anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und befähigt junge Menschen, die Herausforderungen der Zukunft mit Pioniergeist anzugehen.